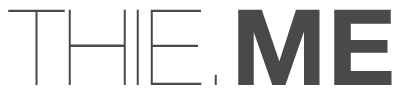Am Fluß
Träge, beinahe ölig fließen die Wasser des Flusses gen Horizont. Wüste Gräser und wildwucherndes Gestrüpp säumen die dunkle Brühe, in der vor Jahrzehnten einmal Kinder planschten und strickende Großmütter ihre dicken Waden kühlten. Früher war hier mehr los.
In den Sommerferien mußte man beim Spazierengehen immer wieder herumtollenden Knirpsen ausweichen, und auf dem Wasser paddelten ganze Familien in holzknarrenden Ruderbooten. Manch einer nahm sogar einen erfrischenden Schluck aus dem glasklaren Fluß, und kein Mensch wäre auf den Gedanken gekommen, seiner Gesundheit einen schlechten Dienst zu erweisen.
Max Billger, ein rüstiger alter Mann von neunundachtzig Jahren, spaziert täglich an diesen inzwischen verwaisten, unkrautüberwucherten Ufern entlang und denkt an frühere Tage. Manchmal bleibt er gedankenversunken stehen, neigt den Kopf, als wolle er einem fernen Geräusch eine Botschaft entnehmen und setzt wenig später wieder bedächtig einen Fuß vor den anderen.
Sie sind alt geworden, der Fluß und der Mann, und sie haben Leute und Ereignisse kommen sehen, die andere nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. Jahrzehnte verbinden sie miteinander, und manchmal scheint es, als gehörten sie auf unbestimmte Weise zueinander, der friedliche alte Mann und der unendliche, gemütliche Fluß.
Die Zeiten haben ihre Spuren hinterlassen. Mehr im Wasser als in diesem Rentner, der, sich oft einsam fühlt und den manches traurig stimmt. Sein Mitgefühl gilt dem Fluß, der alles Unheil ertragend, die Sünden der Menschen in sich aufnimmt und langsam sterbend alles mit sich fortnimmt, ohne zu klagen. Ebenso wehrlos, wie Max Billger sein ganzes Leben lang den Lauf der Dinge ertrug. Manch harter Schlag hatte ihn ereilt, manch Unrecht mußte er über sich ergehen lassen, und bei all den Ereignissen, den guten wie den schlechten, hatte dieser alte Mann zeitlebens ein Herz für seine Mitmenschen gehabt. Die „kleinen“ Leute, die Nachbarn und Kollegen, die Freunde und Bekannten schätzten seine Gelassenheit, Geduld und Toleranz. Er half in manch auswegloser Situation und machte dabei keinen Unterschied zwischen den Menschen, denen er seine Weisheit und Kraft schenkte.
Viele seiner Kollegen besuchten ihn lange nach seiner Pensionierung noch in seiner kleinen Dachwohnung, um sich Rat geben zu lassen oder einfach nur seinen Theorien über Menschlichkeit und Gleichheit zu lauschen. Sein erzählerisches Talent, seine Weitsicht und Offenheit berührten jeden seiner Gesprächspartner, und viele Leute in der Stadt sprachen über ihn, als würden sie von einem Heiligen berichten.
Sein Sohn, der vor etwa zehn Jahren an einem Krebsleiden gestorben war, hatte einmal zu ihm gesagt: „Vater, du bist ein großzügiger Mann. Denkst immer an andere zuerst und gibst ohne zu fordern. Du bist ein Vorbild für jeden Christen, warum bist du eigentlich niemals in die Kirche eingetreten?“ „Ein guter Christ muß nicht zwangsläufig einer Kirchengemeinde angehören“, hatte er damals geantwortet und dabei seine wirklichen Gründe verschwiegen, warum er die Kirche zeitlebens mied.
Schon in seiner frühen Jugend hatte sich in ihm eine gewisse Abneigung gegen die kirchlichen Institutionen entwickelt. Auf seine Fragen nach den Ungerechtigkeiten während der Inquisitionszeit, den Folterungen bei Verhören und den dunklen Machenschaften mit politischen Hintergründen in der Kirchengeschichte, hatte er nie erschöpfende Antworten erhalten. Das Gefühl, konkrete Hinterfragungen von dubiosen Zusammenhängen entweder unbefriedigt oder gar nicht beantwortet zu bekommen, verhalfen ihm nicht gerade zur Vertrauensbildung.
Später wurden gar Verbrechen unter Kirchendächern gedeckt, und als sich nach dem letzten Krieg Dutzende Nazischergen von bestechlichen Würdenträgern unter dem Zeichen des Kruzifix‘ aus Deutschland schmuggeln ließen, kam erstmals so etwas wie Wut in ihm auf. Die Käuflichkeit der DDR-Kirchenvertreter zu Zeiten des kommunistischen Regimes waren nur noch ein Beweis mehr für ihn, daß inmitten dieser kirchlichen Kreise längst nicht alles so sauber vonstatten ging, wie öffentlich immer behauptet wurde. Freilich hatten zahlreiche Christen aus allen kirchlichen Kreisen weltweit immer wieder Beachtliches geleistet. Aber hätten diese Menschen nicht auch als „Ungläubige“ ihre humanitären Ziele verfolgt? Kann nicht auch ein Bild von Menschlichkeit in die Welt getragen werden ohne angelernte oder anerzogene Rituale und Vergötterung einstmals niedergeschriebener Gedanken und Predigten gefühlvoller Menschen?
Für Max Billger gab es kein Bild von Gott, keine Zeremonien und zeitlichen Abläufe seiner Zwiesprache mit dem, was andere als „Macht“ oder Schöpfer betrachteten. Sein Glaube galt immer dem Wort der Bibel, nicht deren Vermarktung oder Darstellung durch die Kirche und irgendwelche Religionsfanatiker. Geht nicht bei allem Aufwand, sich ein vorstellbares Bild über Gott zu schaffen oder für den heutigen Sprachgebrauch kaum noch verständliche Lieder halbherzig zu singen, zu viel Zeit für wirklich Wesentliches verloren?
So trottet der alte Mann kaum hörbar und ebenso gemächlich wie der Fluß zu seinen Füßen durchs Gestrüpp und denkt an all die Erlebnisse zurück, die ihm bei seinen Mitmenschen Respekt und Freundschaft einbrachten. Mancher Zeitgenosse, der von den Wirren des Alltags, von Unrecht oder schweren Schicksalsschlägen betrübt seinen Rat gesucht hatte, kehrte gelassen und stark zu den Seinen zurück, um ehrfürchtig zu berichten: „Der Max hat mir wieder Hoffnung gemacht, der hat das Herz am rechten Fleck.“
Stolz oder Hochmut kannte er nicht, seine Bemühungen galten stets dem Augenblick, den Ängsten und Hoffnungen der anderen und ebenso der Schönheit dieser Welt, die so unermeßlich reich und so unbeschreiblich geschändet war. Wann immer ein Stück aus dieser Welt gerissen wurde, empfand er es als Schmach. Der Lauf der Dinge, die Gewalt des Schicksals machten ihn oft klein vor Traurigkeit. Aber sein Beitrag als Mensch, seinen Platz auszufüllen in Ehrfurcht vor allem Existierenden, erfüllten ihn mit Hoffnung und Kraft.
So erfuhr der alte Mann allmählich vom Gleichgewicht und von der Unantastbarkeit des Seins als etwas Gegebenes, Schützens- und Achtenswertes. Jede noch so unbedeutende Sequenz dieser weltlichen Fülle erschöpfte sich mit jedem Lebensjahr mehr in der unermeßlichen Leere wirklicher Weisheit. Denn: wo Sein wirkt, braucht es lediglich der Leere, um es wirken zu lassen!
So stellte sich dieser Mensch seinem Leben, als wäre es die Aufgabe eines jeden Menschen, sich gleich den Wassern eines Flusses treiben zu lassen. Tragend und ertragend. Spendend und hinnehmend, was ihm gilt. Nur: mit der Leidenschaft eines Menschen wirkend für den Fortbestand der Dinge.
Abendliches Grau verwandelt inzwischen die Flußufer in farblose Schattenfiecke. Der matte Glanz des ruhig dahingleitenden Wassers spiegelt die letzten dumpfen Lichter des ermattenden Himmels. Der Gang des alten Mannes verlangsamt sich. Gegen den trist-dunklen Horizont zeichnen sich schwach die Konturen eines zweiten abendlichen Spaziergängers ab. Zwei Meter vor dem noch immer nicht genau erkennbaren Fremden will der alte Mann die Richtung wechseln. Doch der andere spricht ihn an.
Wärme und unglaubliche Friedlichkeit empfindend, vernimmt er eine ruhige, männliche Stimme. Nie gekannte Weichheit liegt in den Schwingungen der Worte. Wie ein lieblicher, leiser Singsang einer meisterlichen Oboe dringt der Satz an sein Ohr:
„Bitte komm näher, mein Freund. Ich habe dich erwartet.“ Seinen Sinnen kaum trauend, bewegt sich der Alte zögernd auf den Fremden zu. Dieser macht gleichsam einen bedächtigen Schritt auf ihn zu, und einen Augenblick lang sehen sich die beiden Männer mit gespannter Neugier in die Augen. Von unsäglicher Überraschung beim Anblick des anderen gepackt, findet der Alte zunächst keine Worte.
Da legt ihm der Fremde, der lediglich mit einem leichten Gewand bekleidet ist, die Hand auf die Schulter und spricht im gleichen sanften Tonfall zu ihm: „Da ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen; aber du wirst mir hernachmals folgen.“
Der Alte senkt wie beschämt den Kopf und zittert unter erschütterten Tränen. Nach Sekunden der Stille blickt er dem anderen von unten her mit wäßrigen Augen ins Gesicht und wispert, noch immer unter Zittern: „So sprachst du einstmals zu mir, aber ich habe dich dreimal verleugnet, Herr, wie du es weissagtest.“
Leicht, kaum spürbar schüttelt der Fremde den Kopf, rückt noch ein Stück näher an den Alten und nimmt ihn behutsam in seine Arme.
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“
Schluchzend und tränen-überströmt klammert sich der Greis an den Fremden, lehnt sein graues Haupt an dessen Schulter und sendet einen unendlich glücklichen Blick zum Fluß hin.
Wenig später schließt er seine Augen und hört auf zu atmen. Die leblose Hülle des alten Mannes haltend, blickt der Fremde auf den Fluß und sagt die Worte voller wärmender Liebe:
„Du tatest Gutes am Menschen und Gutes an der Welt. Du hast verkündigt, was ich dermaleinst lehrte, Petrus. Nun laß uns beim Vater sein, in alle Ewigkeit!“
*Hier klicken zum Start des Erzählungsbandes -> “M.O. Und andere Geschichten aus dem 4. Reich” von Jens Thieme, 1994.